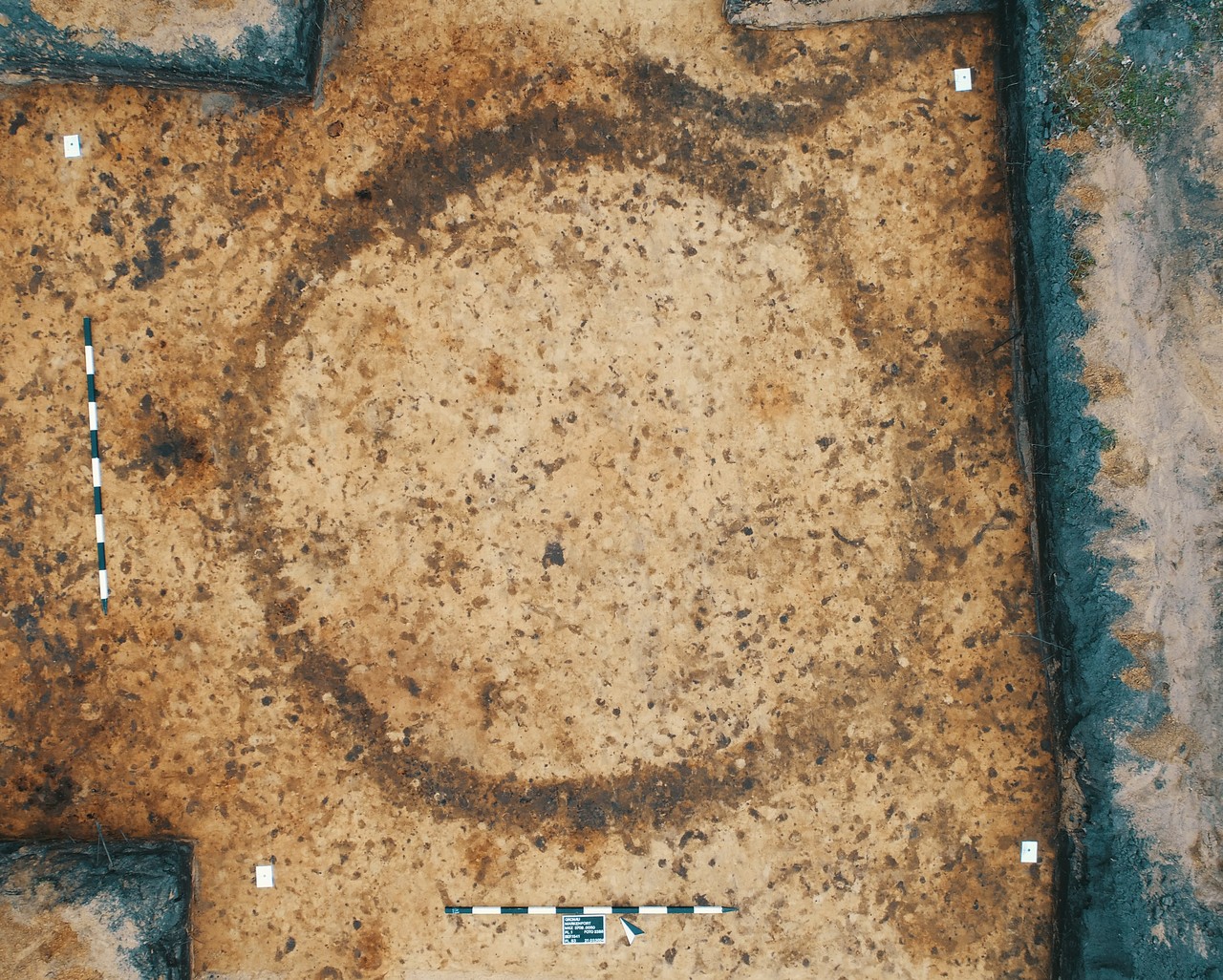Am nördlichen Rand der Stadt Gronau (Westf.), in weniger als 1 km Entfernung zur niederländischen Grenze, soll ein Neubaugebiet im Bereich des ehemaligen Bauernhofs Markenfort entstehen.
Durch eine Voruntersuchung der LWL-Archäologie für Westfalen im Jahr 2020 ist bekannt, dass in diesem Bereich eine bedeutsame archäologische Fundstelle liegt.
Die Stadt Gronau beauftragte deshalb die Fachfirma Salisbury Archäologie GmbH mit den notwendigen bauvorgreifenden archäologischen Ausgrabungen.
Die Grabungsleitung teilten sich Gerard Aalbersberg und Stephan Deiters; die Ausgrabungen dauerten von Februar 2023 bis August 2024, also etwa 18 Monate.
Die Fundstelle liegt etwa 350 m östlich der Dinkel in etwas erhöhter Lage über der Flussniederung. Unter vor- und frühgeschichtlichen Bedingungen stellte dies eine vorteilhafte Siedlungslage dar: In der Nähe eines Fließgewässers, dabei aber hochwassergeschützt und gleichzeitig am Schnittpunkt verschiedener Biotope, so dass man mehrere unterschiedlich nutzbare Landschaftselemente in der Nähe hatte. Tatsächlich stellte sich im Laufe der Ausgrabung heraus, dass der Ort immer wieder Menschen angezogen hat, wie Funde und Befunde gänzlich unterschiedlicher Zeitstellung zeigen.
Die ältesten Funde stammen aus der Steinzeit, genauer gesagt aus dem Mesolithikum. In dieser Zeitperiode lebten nach dem Ende der letzten Eiszeit Gruppen von Menschen in der wieder bewaldeten Landschaft. Sie ernährten sich von der Jagd, dem Fischfang und dem Sammeln von Früchten, Nüssen u.ä. Diese Lebensweise erforderte eine relativ häufige Verlegung der Lagerplätze, um die Nahrungsversorgung sicherzustellen.
Bei aufwändigen Rasteruntersuchungen im Westen der Fundstelle, bei denen der gesamten Aushub durchgesiebt wurde, wurden mehr als 8.000 FeuersteinArtefakte dieser Zeit gefunden. Viele davon stammen aus einer ehemaligen Senke, die schon vor langer Zeit verfüllt worden war.
Eine genauere Analyse zeigt, dass Mesolithiker ab etwa 7.000 v. Chr. (möglicherweise auch schon deutlich früher) hier über einen langen Zeitraum wiederholt ihr Lager aufschlugen.
Zusätzlich lassen insbesondere charakteristische Pfeilbewehrungen aus Feuerstein darauf schließen, dass diese Jäger und Sammler nicht isoliert lebten, sondern Kontakte zu weiter westlich lebenden Gruppen in den Niederlanden und Belgien gehabt haben müssen (sog. Rhein-Maas-Schelde-Gruppe).