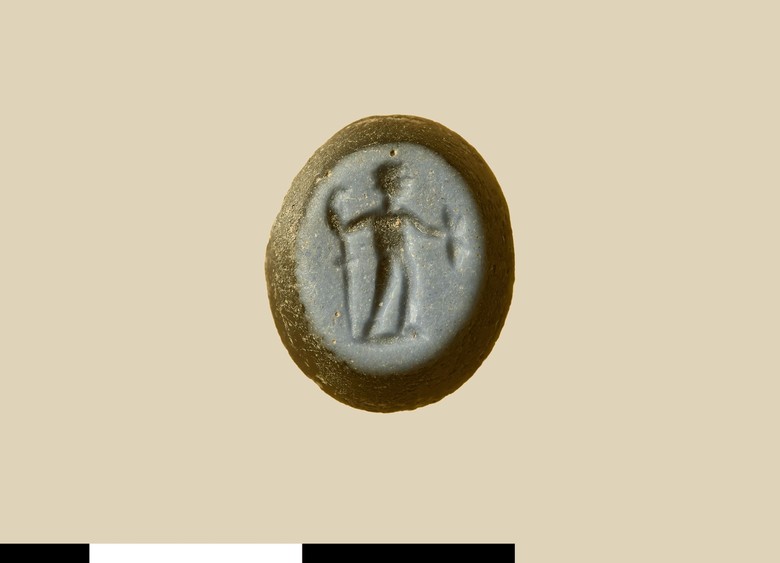Die neuen Ausgrabungen 2024/25 zeigten dann, dass auf dem hochwassergeschützten Areal südlich der Lippe wohl schon in der älteren Römischen Kaiserzeit ein Siedlungsplatz bestand und es auch noch eine völkerwanderungszeitliche Besiedlung gegeben hatte. Dass das Areal aber nicht nur als Siedlungs- sondern auch als Bestattungsplatz gedient hatte, beweist ein Brandgrubengrab.
Das Grab barg nicht nur Scheiterhaufenreste wie Holzkohle und unter hohen Temperaturen verbrannte Knochen (sog. Leichenbrand), sondern auch Teile von mitverbrannten Beigaben, darunter eine Tierkopfschnalle mit Beschlägen, eine Lanzenspitze, zwei Fibeln, einen in viele Stücke zerbrochenen Kamm aus Knochen und einen Feuerstahl. Die Schnalle belegt, dass der im 4./5. Jahrhundert n. Chr. bestattete Mann einen römischen Militärgürtel besaß. Vielleicht hatte er zu Lebzeiten als germanischer Söldner im römischen Militär gedient und das Ausrüstungsstück später mit in die Heimat gebracht? Das Bentfelder Grab ist ein besonders wichtiger Befund, weil es in Ostwestfalen die erste Bestattung ist, in dem Teile eines römischen Militärgürtels nachgewiesen werden konnten; diese waren hier, anders als in anderen Regionen, bisher nur aus Oberflächenfunden belegt.