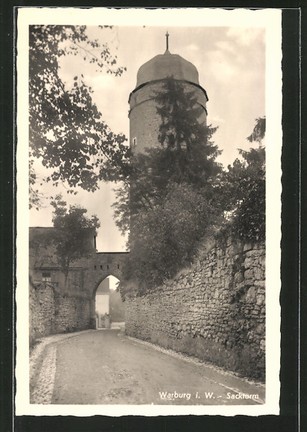Die umfangreichsten Erkenntnisse konnten die Archäologen auf der südlichen Teilfläche gewinnen. Hier kamen nicht nur Reste der originalen Bausubstanz der mittelalterlichen Burgmauer, sondern auch komplexe Erdschichten zum Vorschein, die Aufschluss über die Innenbebauung, über Nutzungszeiträume und katastrophale Ereignisse geben. „Das Burgareal ist ab dem 19. Jh. als Friedhof genutzt worden – daher war mit Ergebnissen in dieser Qualität nicht zu rechnen“ schildert Dr. Hans-Werner Peine. Im Boden blieben die Spuren von drei Bränden konserviert. Sie sind anhand von schwarzen Bändern in den Erdschichten zu erkennen. Die Keramik, die in diesen Brandschichten erhalten geblieben ist, stammt aus dem hohen und späten Mittelalter. Entsprechend muss es in diesen Zeiträumen zu den Zerstörungen durch Feuer gekommen sein. Auch steinerne Fundamente kamen zum Vorschein. Ihre Struktur deutet darauf hin, dass sich darüber früher ein Fachwerkbau erhoben hat.
Zu den weiteren Funden gehören Keramikscherben und Eisenobjekte. Die meisten stammen aus der Zeit des 12. bis 14. Jahrhunderts. Diese Zeitspanne scheint somit den Hauptnutzungszeitraum der Burganlage zu umfassen. Einige wenige Scherben sind jedoch älter und zeigen, dass durchaus schon im 10. Jahrhundert Menschen den Burgberg bewohnten und nutzten. „Genaueres wird aber erst die endgültige Auswertung des Fundmaterials ergeben“, so Peine.
Auf der nördlichen Teilfläche des Ausgrabungsareals hatten es die Archäologen mit einem ganz anderen Thema zu tun. Hier liegt der vornehmlich historische und bis heute genutzte Burgfriedhof. Insgesamt drei Bestattungen konnten im Bereich eines Weges zwischen den modernen Grabbereichen untersucht werden. Sie stammten aus den späten 1860er und frühen 1870er Jahren und gehörten damit zur ersten Belegungsphase des Friedhofes. Neben den Skeletten dokumentierten die Archäologen Reste der zugehörigen Särge, von denen teilweise noch die Zierbeschläge aus Metall erhalten waren, sowie einzelne Knöpfe der Totenhemden. „Darüber hinaus fanden wir in einem Grab die Reste eines filigranen bronzenen Rosenkranzes, dessen Freilegung einiges an Geschick erforderte“, erläutert Grabungsleiter Kim Wegener. Hier mussten die Archäologen tatsächlich zum Pinsel greifen, um ihn behutsam freizulegen. Dieses Arbeitsinstrument kommt entgegen allen Vorurteilen sonst nur selten zum Einsatz.